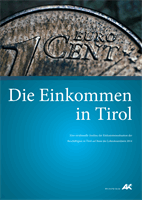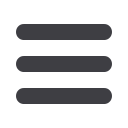

Seite 12 Die Einkommen in Tirol
Die Frage der Wirtschaftsstruktur und des Einkom-
mens hängen eng miteinander zusammen. Wert-
schöpfungsintensive Wirtschaftszweige, die ein
hohes Maß an Know-how voraussetzen, werden
in der Regel höhere Einkommen bieten. Dagegen
sind Dienstleistungen, welche ein geringeres Maß
an spezifischem Fachwissen voraussetzen und die
deshalb aus einem großen Pool an Bewerberinnen
und Bewerbern am Arbeitsmarkt schöpfen können,
generell niedriger entlohnt. Der strukturelle Wandel
in der Wirtschaft übt deshalb einen starken Einfluss
auf die jetzigen und künftigen Einkommenschancen
der Bevölkerung aus.
Ein Vergleich der Branchenstruktur mit der Anzahl
des jeweiligen Beschäftigtenstandes in den großen
Branchen der österreichischen Wirtschaft bietet in-
teressante Aufschlüsse. Trotz der nur geringen wirt-
schaftlichen Dynamik im Jahr 2014 war die Zahl der
Beschäftigten in Österreich nach wie vor im Steigen.
Im Vergleich zum Jahr 2013 lag der Beschäftigten-
stand im Jahr 2014 um über 28.000 Personen höher,
was einer Steigerung von 0,7% entsprach. Der größ-
te Zuwachs an Beschäftigung in absoluten Zahlen
fand im Bereich der öffentlichen Verwaltung, Erzie-
hung und Unterricht und der Gesundheits- und Sozi-
aldienstleistungen statt. In diesen Branchen kamen
im Jahresvergleich 10.491 Personen (+1,1%) hinzu.
Zusammen mit der Zunahme in den sonstigen wirt-
schaftlichen Dienstleistungen (+7.267 Personen bzw.
+3,0%), einem Wirtschaftsabschnitt, der eine Vielfalt
verschiedenster Dienstleistungen, wie etwa Security-
Services, Reinigungsleistungen, vor allem aber auch
die Arbeitskräfteüberlassung beinhält, zeigte sich in
Österreich ein Trend hin zu einer Verlagerung der
Beschäftigung zum tertiären Sektor. Rückgängig war
die Beschäftigung in der Sachgüterproduktion (In-
dustrie und Gewerbe)und im Baubereich. Die Zahl
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesen
Branchen ging um 954 (-0,1%) bzw. 890 Personen
(-0,3%) zurück. Die Zahl der unselbständig Beschäf-
tigten im Handel reduzierte sich im Jahresvergleich
um 664 Personen (-0,1%).
Tirol wies 2014 eine positive Beschäftigungsbilanz
auf. Insgesamt stieg die Zahl der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer um 3.562 Personen an (+0,9%).
Das weitaus stärkste Beschäftigungswachstum wie-
sen die „sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen“
auf. Die Zahl der in dieser Branche beschäftigten
Personen stieg um 7,5% (+1.150 Personen) an –
der deutlichste Anstieg in allen österreichischen
Bundesländern! Dazu kam noch eine dynamische
Beschäftigungsentwicklung im Bereich der öffentli-
chen Verwaltung, Schulen und im Bereich der Ge-
sundheitsdienstleistungen (+1.593 Personen bzw.
+1,9%), sodass auch für Tirol der Dienstleistungsbe-
reich der wesentliche Treiber der Beschäftigungsent-
wicklung war.
3.1 Ganzjährige Beschäftigung in Österreich
Das Ausmaß der Zeit, die in ein Beschäftigungsver-
hältnis investiert wird bzw. werden kann, bestimmt
nach wie vor wesentlich über das erzielbare Einkom-
men. Gerade in Tirol ist ein saisonal strukturiertes Ar-
beitsjahr für viele Menschen ein großer Einflussfaktor
auf ihr Einkommen. Tirol ist in Österreich das Touris-
musland Nummer Eins, so überrascht es auch nicht,
dass der Anteil der ganzjährigen Arbeit in Tirol von
allen Bundesländern am niedrigsten ist. Etwas mehr
als zwei Drittel (68,5%) der Tiroler Beschäftigten ging
2014 einer ganzjährigen Arbeit nach – ungeachtet
ob Vollzeit oder Teilzeit, im österreichischen Durch-
schnitt waren es fast drei Viertel (74,4%). Wenig
Unterschiede gab es dabei zwischen Männern und
Frauen. In der österreichischen Gesamtbetrachtung
war es 2014 sogar so, dass Frauen (Anteil: 74,8%)
geringfügig öfter einer ganzjährigen Beschäftigung
nachgingen als die Männer (74,0%). Nicht so in Tirol:
hier standen die Männer häufiger in einer ganzjähri-
gen Beschäftigung (Anteil 69,1%), was wohl auch im
sehr hohen Anteil des Tourismus an der Frauenbe-
schäftigung in Tirol begründet liegen dürfte (Frauen
Anteil: 67,9%).
(3) Die Struktur der Beschäftigung in den Bundesländern
ganzjährig
Vollzeit
53,1%
ganzjährig
74,4%
Grafik 4: Anteile ganzjähriger Arbeit und ganzjähriger Voll-
zeitarbeit in Österreich