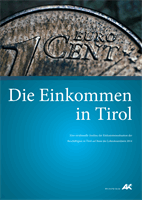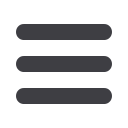

Analyse Lohnsteuerdaten 2014 Seite 17
Neben dem zeitlichen Ausmaß einer Tätigkeit ist die
Art der Tätigkeit bzw. die Branche ein weiterer be-
stimmender Faktor für die Höhe des Einkommens.
Die Daten der Lohnsteuerstatistik erlauben eine Zu-
ordnung der Beschäftigten nach den verschiedenen
Wirtschaftsabschnitten vorzunehmen und dadurch
ein detailliertes Bild der Beschäftigungsstruktur einer
Region zu erhalten. Die Höhe der Einkommen nach
Branche variieren teilweise beträchtlich.
So lagen beispielsweise die Einkommen in der Tiroler
Sachgütererzeugung rund 51% höher als diejenigen
in Beherbergung und Gastronomie – bei ganzjähri-
ger Vollzeitbeschäftigung. Einkommensunterschiede
zwischen Männer und Frauen resultieren auch aus
der Verteilung der männlichen und weiblichen Be-
schäftigten über die verschiedenen Wirtschaftsbran-
chen. Einkommensstarke Wirtschaftsbereiche, wie
etwa die Sachgütererzeugung, sind stark männlich
dominiert, während Branchen mit einem niedrigeren
Einkommensniveau, beispielsweise das Gastgewer-
be, hohe Anteile weiblicher Arbeitskräfte aufweisen.
Hinzu kommen die oftmals unterschiedlichen Tätig-
keiten innerhalb einer Branche.
So wird etwa eine Sekretariatskraft in einem Indust-
riebetrieb zwar dem Bereich „Sachgütererzeugung“
zugeordnet, erzielt aber bei weitem nicht das Ein-
kommensniveau eines hochspezialisierten Fach-
arbeiters. Unterschiedliche Verteilungen über die
Branchen und die verschiedenartigen Tätigkeits-
felder innerhalb der Branchen resultieren in erheb-
lichen Einkommensunterschieden zwischen den
Geschlechtern. Die Tatsache, dass Frauen sehr viel
häufiger in Teilzeit arbeiten, kommt noch verstärkend
hinzu.
In der Analyse finden sich der Übersichtlichkeit we-
gen die beschäftigungsstärksten Wirtschaftsklassen:
Herstellung von Waren (ÖNACE „C“), Bau (ÖNACE
„F“), Handel (ÖNACE „G“), Verkehr und Lagerei (ÖN-
ACE „H“), Beherbergung und Gastronomie (ÖNACE
„I“), Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleis-
tungen (ÖNACE „N“) und öffentliche Verwaltung,
Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und
Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen (ÖNACE
„O+P+Q“), diese werden um der Kürze willen in der
Folge als „öffentlichkeitsnaher Sektor“ bezeichnet.
Zusammen umfassten diese genannten beschäfti-
gungsstarken Wirtschaftsklassen im Jahr 2014 rund
81% aller Beschäftigten in Österreich und rund 85%
der Beschäftigten in Tirol.
4.1 Der öffentlichkeitsnahe Sektor
Die größte Beschäftigungsbranche in Österreich war
der öffentlichkeitsnahe Sektor, der von den ÖNACE-
Abschnitten O, P und Q gebildet wird. Darunter fallen
die Bereiche öffentliche Verwaltung und Sozialver-
sicherung (ÖNACE „O“), Erziehung und Unterricht
(ÖNACE „P“) und das gesamte Gesundheits- und
Sozialwesen (ÖNACE „Q“). In Österreich erzielten
mehr als eine Million Menschen (1.004.161 Perso-
nen)im öffentlichkeitsnahen Sektor ihr Hauptjah-
reseinkommen – fast ein Viertel aller unselbständig
Beschäftigten in Österreich. In Tirol waren es 86.600
Personen oder 23% der Beschäftigten. Zahlenmäßig
war der öffentlichkeitsnahe Bereich eine weibliche
Branche: innerhalb der Branche waren rund zwei
Drittel der Beschäftigten und ein Drittel aller weibli-
chen Beschäftigten in Österreich arbeitete in einem
diesen personalintensiven Dienstleistungen der öf-
fentlichen Hand.
Etwas mehr als die Hälfte (53%) der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer im öffentlichkeitsnahen Be-
reich in Österreich tat dies im Rahmen einer ganzjäh-
rigen Vollzeitbeschäftigung. In Tirol lag der Anteil der
ganzjährig Beschäftigten mit 47% deutlich niedriger.
Das Geschlechterverhältnis bei den ganzjährig Voll-
zeitbeschäftigten im öffentlichen Bereich war dabei
annähernd ausgeglichen: in Tirol waren 52% Män-
ner, 48% Frauen.
Das durchschnittliche Jahresnettoeinkommen in
den öffentlichkeitsnahen Sektoren lag 2014 bei EUR
22.579. Die Topverdienerinnen und –verdiener waren
in Niederösterreich und Kärnten zu finden (jeweils
+3% ggü. AUT-ø). Das Schlusslicht bildete Oberös-
terreich mit durchschnittlich EUR 21.400 und einem
Einkommensrückstand von 5% gegenüber dem Ös-
terreichschnitt. Tirol folgte an vorletzter Stelle mit ei-
nem Einkommensdurchschnitt von EUR 21.415.
Diese schlechte Platzierung Tirols lag an den ver-
gleichsweise geringeren Einkommen der Frauen in
der Branche. Während die Einkommen der Männer
exakt dem österreichischen Schnitt entsprachen,
lagen die Frauen um 9% darunter, wodurch sie die
deutlich letzten im Bundesländervergleich waren. Bei
ganzjähriger Vollzeitarbeit wurde im öffentlichkeits-
nahen Bereich von den Männern ein Nettojahresein-
kommen von durchschnittlich EUR 34.618 erzielt und
von den Frauen eines von EUR 28.971.
(4) Beschäftigung und Einkommen nach Wirtschaftsabschnitt